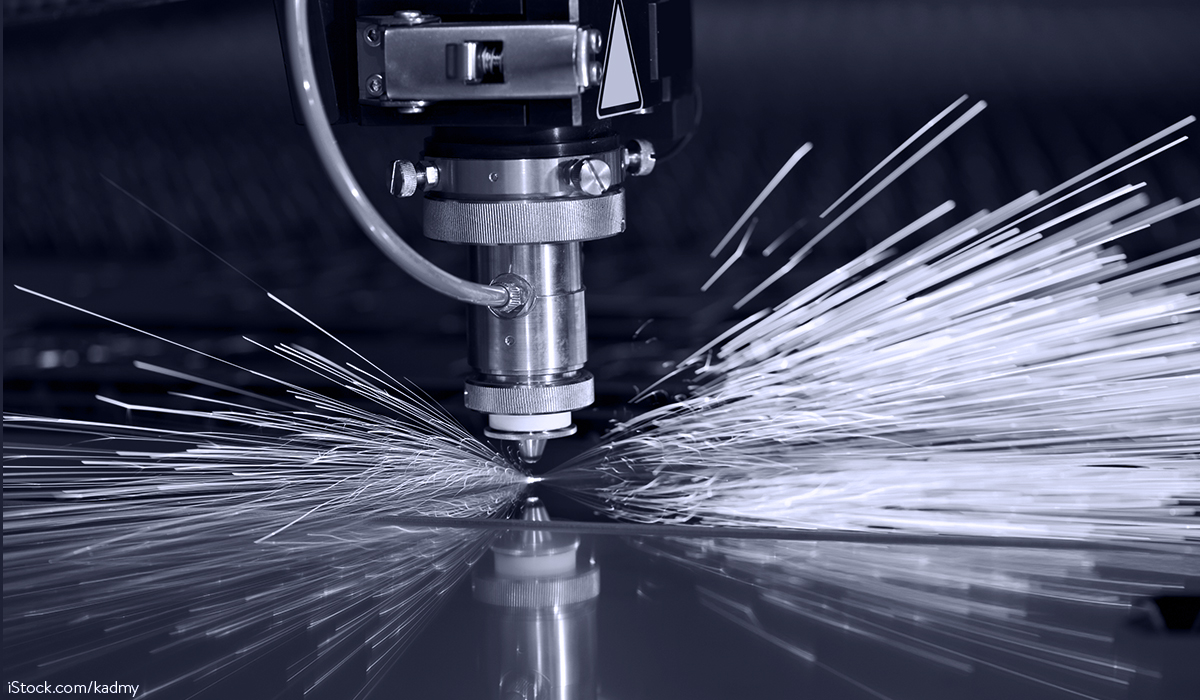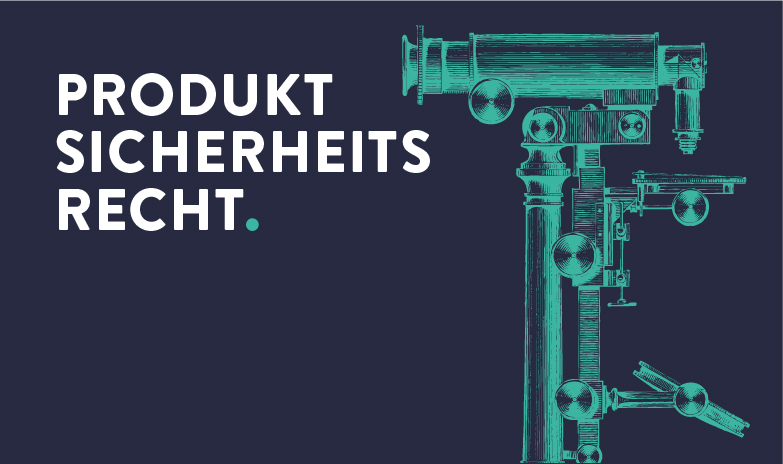A. Die neue EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Die GPSR gilt EU-weit seit dem 13.12.2024 und damit noch keinen ganzen Monat. Zugleich wurde die Richtlinie 2001/95/EG (sog. Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie) aufgehoben. Der Vollzug der GPSR steckt damit noch in den Kinderschuhen. Insoweit wird spannend zu beobachten sein, wie die Marktüberwachungs- und Zollbehörden sowie Wirtschaftsakteure (im Wettbewerbsrecht) mit den zahlreichen offenen Rechtsfragen verfahren werden, die derzeit diskutiert werden. Exemplarisch seien
- die Anforderungen an die elektronische Adresse in Form einer Internetadresse z.B. im Rahmen der Herstellerkennzeichnung gemäß Art. 9 Abs. 6 GPSR,
- die mitunter schwer zu erfüllenden Online-Vorgaben beim Verkauf gebrauchter Produkte gemäß Art. 19 GPSR,
- die Verbraucherkommunikation gemäß Art. 35 Abs. 4 S. 1 GPSR, die darauf hinauslaufen soll, möglichst alle Nutzer zu erreichen oder
- das nach wie vor ungeklärte Verhältnis der GPSR zum CE-Recht aus dem harmonisierten Bereich in Bezug auf die Artt. 9 ff. GPSR, d.h. die Pflichten der Wirtschaftsakteure,
genannt.
Dass die Europäische Kommission diesbezüglich keine Hilfe darstellen wird, dürfte mehr oder weniger feststehen. Sie macht es sich jedenfalls zu leicht, wenn sie in den jüngst veröffentlichten FAQ (dazu sogleich) erneut – ohne jede Begründung – nachbetet, dass der GPSR im Verhältnis zum CE-Recht keine „Lückenfüllerfunktion“ bei den Pflichten der Wirtschaftsakteure zukommen soll. Dass diese Sichtweise in mehreren Hinsichten zu schlechterdings unhaltbaren Ergebnissen bei der Rechtsanwendung führt, scheint nach wie vor in Brüssel nicht angekommen zu sein. Und die missglückte Abgrenzungsformel in Art. 2 Abs. 1 GPSR erlaubt eine Dachfunktion der GPSR ohne Weiteres, wenn und weil eben nur „die spezifischen Anforderungen der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“ Vorrang genießen sollen. Nach wie vor müssten die Anhänger der „Trennungsthese“ erklären, warum es etwa im Maschinenrecht seit dem 13.12.2024 weder Einführer- noch Händlerpflichten bei Maschinen, die Verbraucherprodukte sind, geben soll – Pflichten, die es bis zum 13.12.2024 ohne Weiteres gab, weil der Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie eine Dachfunktion innewohnt, Art. 1 Abs. 2 Unterabs. 2 lit. b) Richtlinie 2001/95/EG. Auch im Übrigen spielt die Kommission bislang eine unheilvolle Rolle bei der Auslegung der GPSR. Warum etwa die Anforderung der elektronischen Adresse nur erfüllt sein soll, wenn der Link namentlich zu einem Kontaktformular führt, bleibt mit Blick auf den Wortlaut der betreffenden Norm(en) schleierhaft. Gleichwohl sind die (insoweit gleichlautenden!) Aussagen aus dem staatlichen Bereich – die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik [ZLS] und das national federführende Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz [BMUV] sehen es nicht anders – ernst zu nehmen, weil sie erfahrungsgemäß den Vollzug in der Europäischen Union (EU) stark prägen werden.
Da sich die Europäische Kommission zwecks Konkretisierung der GPSR bislang mit ebenso dünnen wie wenig aussagekräftigen FAQ „EU General Product Safety Regulation“ begnügt hat, fehlen noch immer ihre in der GPSR ausdrücklich genannten Leitlinien. Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass es zeitnah die folgenden Leitlinien geben wird, auch wenn es in der GPSR selbst keine Frist für die Erstellung bzw. Veröffentlichung durch die Europäische Kommission gibt:
- Leitlinien für die Wirtschaftsakteure mit besonderem Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Art. 17 Abs. 2 Unterabs. 2 GPSR
- Leitlinien für die praktische Umsetzung des Safety-Business-Gateway, Art. 27 Abs. 2 GPSR
Teil der Leitlinien soll auch ein Muster (model template) für die technische Dokumentation (technical documentation) sein. Einschlägige Entwürfe liegen uns vor – sie deuten an, dass es die Europäische Kommission insoweit eher einfach und damit industriefreundlich halten möchte. Dass das Muster erst nach dem Geltungsbeginn der GPSR veröffentlicht werden soll, passt freilich ins Bild einer für die Gewährleistung der Rechtssicherheit bislang wenig hilfreichen Exekutive.
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die „Fragen und Antworten zur Allgemeinen EU-Produktsicherheitsverordnung (VO (EU) Nr. 2023/988)“, die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz herausgegeben werden.
Abschließend wird in den beteiligten Kreisen damit gerechnet, dass der erste Aufschlag zwecks Konkretisierung der GPSR national durch die Zivilgerichte erfolgen wird. Dies liegt daran, dass es gerade bei den formellen (Kennzeichnungs-)Anforderungen an die Verkehrsfähigkeit einerseits und den informationellen Vorgaben an Angebote im Fernabsatz im Allgemeinen bzw. im Online-Handel im Besonderen gemäß Art. 19 GPSR andererseits einen fruchtbaren Boden für genuin wettbewerbsrechtliche Angriffe gibt. Dies wird vermutlich das ein oder andere Unternehmen zum Vorgehen gegen unliebsame Wettbewerber motivieren. Ob damit ein hilfreicher Beitrag für die Entwicklung dogmatischer Strukturen zwecks besserer Handhabung der GPSR geleistet wird, darf mit Blick auf eine ganze Reihe bestenfalls seltsamer zivilgerichtlicher Entscheidungen zum Produktsicherheitsrecht in der Vergangenheit mehr als bezweifelt werden.
B. Reform des nationalen Produktsicherheitsrechts
Mit Blick auf die GPSR war der nationale Gesetzgeber an sich dazu aufgerufen, bis zum 13.12.2024 für eine flankierende Reform des Gesetzes über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) zu sorgen. Nachdem das ProdSG erst im Jahr 2021 reformiert wurde, um das nationale Produktsicherheitsrecht an die EU-Marktüberwachungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/1020) anzupassen (was sich freilich insbesondere am Erlass des Marktüberwachungsgesetzes [MüG] manifestierte), bedarf es nunmehr der Synchronisierung des ProdSG 2021 mit der GPSR.
Tatsächlich ist das Gesetzgebungsverfahren indes ins Stocken geraten. Ursächlich dafür war das Scheitern der „Ampel-Koalition“ kurz vor dem Geltungsbeginn der GPSR am 13.12.2024. So wurde der entsprechende Vorgang jüngst abermals in die Ausschüsse (insbesondere den Ausschuss für Arbeit und Soziales, den Wirtschaftsausschuss und den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) verwiesen, weil namentlich die FDP „eine klügere Lösung“ von der neuen Regierung erwartet, die auf weniger „Belastungen für unsere Unternehmen“ und mehr Entlastung setzt. Die FDP stört sich nicht zuletzt am hohen Bußgeldrahmen i.H.v. bis zu EUR 100.000,00 bei den gravierenden Ordnungswidrigkeitentatbeständen. Dies sei gerade im Vergleich zu Italien (EUR 50.000,00) und Österreich (EUR 25.000,00) zu viel des Guten (vgl. Plenarprotokoll 20/202 vom 04.12.2024, 26074 f.).
Bis auf Weiteres gilt also das ProdSG 2021 fort, das freilich inzwischen weitgehend von der GPSR überlagert wird. Ungeregelt bleibt daher etwa die Sprache bei den GPSR-spezifischen Informationen, Anweisungen und Warnhinweisen, die in § 6 ProdSG-E vorgesehen ist. Die geplante Regelung geht bekanntlich über § 3 Abs. 4 ProdSG 2021 hinaus. Erfreulich für die Wirtschaft ist demgegenüber, dass die zahlreichen Ordnungswidrigkeitentatbestände in § 28 Abs. 2 ProdSG-E mit Bezug zur GPSR noch nicht „scharf gestellt“ sind. Unproblematisch ist die Weitergeltung in Bereichen, die ohnehin nicht im Fokus des Reformgesetzgebers standen. So soll das Recht des GS-Zeichens in den §§ 20 ff. ProdSG 2021 nahezu unangetastet bleiben, zumal es sich insoweit ohnehin um genuin nationales Produktsicherheitsrecht handelt. Nicht-harmonisierte B2B-Produkte, die freilich eher selten eine Rolle spielen, sind und bleiben am Maßstab des ProdSG zu messen.
Abzuwarten bleibt, ob es nach 2013 (3. Auflage) noch einmal Leitlinien des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) zum nationalen Produktsicherheitsrecht geben wird. Aufgrund der sinkenden Bedeutung des genuin nationalen Produktsicherheitsrechts ist dies wohl eher nicht mehr zu erwarten, zumal sich der LASI scheuen dürfte, der Kommission Konkurrenz bei der Auslegung der (unionsrechtlichen) GPSR zu machen. Gleichwohl wäre dies zu bedauern, weil die LASI-Leitlinien zu jenen Hilfsmitteln im Produktsicherheitsrecht rechnen, die tatsächlich einen Mehrwert bieten, weil sie nicht nur praxisnah sind, sondern auch pragmatischen Lösungen ein Wort reden.
C. Neue EU-Spielzeugverordnung
Die Reform des europäischen Spielzeugrechts verzögerte sich zuletzt fraglos, nachdem der Prozess am 28.07.2023 mit dem Vorschlag der Kommission über eine Verordnung für die Sicherheit von Spielzeug (COM(2023) 462 final) begonnen hatte. Aus dem staatlichen Bereich war jüngst indes zu hören, dass das Gesetzgebungsverfahren gleichwohl voranschreite. So soll es laut sachkundigen Aussagen auf der jüngsten Marktüberwachungskonferenz in Berlin in den kommenden beiden Quartalen so weit sein, dass die neue EU-Spielzeugverordnung veröffentlicht werden kann.
Erst im Herbst 2024 starteten die Trilogverhandlungen nach der Europawahl, nachdem zuvor das Parlament im März und der EU-Ministerrat im Mai 2024 seine bzw. ihre jeweilige Position festgelegt hatten. Inhaltlich wird es danach bei der Einführung eines digitalen Produktpasses (DPP) bleiben, der zum einen die Möglichkeiten der Marktüberwachungsbehörden verbessern und zum anderen Verbrauchern/-innen den Zugriff z.B. auf sicherheitsrelevante Informationen (namentlich über einen QR-Code) erleichtern soll.
Was den DPP anbelangt, soll es – mit Blick auf die ökodesignrechtliche Regulierung – nicht mehrere Produktpässe geben. Vielmehr ist dergestalt eine Zusammenfassung geplant, dass es in Zukunft für ein einziges Produkt nur einen einzigen DPP geben soll.
D. Reform des nationalen Maschinenrechts
Nachdem die neue Maschinenverordnung (im Folgenden „MVO“) am 29.06.2023 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden war, begannen inzwischen die Arbeiten am neuen nationalen Maschinenrecht. Ausdruck fanden diese Bemühungen jüngst im Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuregelung maschinenrechtlicher Vorschriften (BT-Drs. 20/14145).
Allerdings werden die wesentlichen Bestandteile des neuen Maschinenrechts im laufenden Jahr 2025 noch nicht zu beachten sein. Geltungsbeginn für die Allgemeinen Bestimmungen oder die Pflichten der Wirtschaftsakteure wird vielmehr erst am 20.01.2027 sein, Art. 54 Unterabs. 2 MVO. Im Zentrum des nationalen Maschinenrechts wird in Zukunft ein Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2023 über Maschinen und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 73/361/EWG des Rates stehen. Vergleichbare Gesetzgebungstechniken haben wir auf nationaler Ebene zuletzt im Jahr 2019 bei der flankierenden Gesetzgebung zu den europäischen PSA- und Gasgeräte-Verordnungen gesehen, als das PSA-DG und das GasgeräteDG die Bühne betraten. Das Maschinen-Durchführungsgesetz (MaschinenDG) soll den Art. 1 und damit das Herzstück des zugrunde liegenden, indes aus nur drei Artikeln bestehenden Artikelgesetzes bilden.
Das MaschinenDG wird den sachlichen Anwendungsbereich der EU-Maschinenverordnung abbilden (§ 1) und die deutsche Sprache insbesondere für die Anleitungen und die EU-Konformitätserklärung vorgeben (§ 2). Während sich die §§ 5 f. MaschinenDG mit (relevanten) marktüberwachungsrechtlichen Themen befassen, regeln die §§ 8 f. MaschinenDG die Bußgeld- (§ 8) und Strafvorschriften (§ 9). Dabei dürfte den Strafvorschriften – wie üblich – kaum praktische Relevanz zukommen. Bei den Ordnungswidrigkeiten gibt es hingegen derzeit nicht weniger als 25 (!) Einträge, sodass namentlich die Maschinenhersteller beizeiten einen Blick in den Katalog werfen sollten. Folgerichtig wird der Anwendungsbeginn für die genannten §§ 1 f., 8 f. MaschinenDG auf den 20.01.2027 festgelegt, § 12 MaschinenDG. Dass wiederum die 9. ProdSV (sog. Maschinenverordnung) mit Wirkung vom 20.01.2027 aufgehoben werden soll, folgt aus den Artt. 2, 3 Abs. 2 des Artikelgesetzes. Die bis dahin noch gültige Maschinenverordnung dient dem Zweck, die Bestimmungen aus der Richtlinie 2006/42/EG (sog. EG-Maschinenrichtlinie) in nationales Recht zu transformieren. Die Notwendigkeit einer nationalen Umsetzung unionaler Vorgaben besteht aufgrund des Rechtsformwechsels im Maschinenrecht von der Richtlinie hin zur Verordnung in Zukunft nicht mehr. Ausreichend sind in diesem Szenario schlanke Durchführungsbestimmungen, welche Gegenstand des MaschinenDG sein werden.
Zur Vertiefung: Schucht/Wiebe, EU-Produktsicherheitsverordnung. General Product Safety Regulation, 2025; Schucht/Wiebe, Die neue EU-Produktsicherheitsverordnung. General Product Safety Regulation (GPSR), 2024
Haben Sie zu dieser News Fragen oder wollen Sie mit dem Autor über die News diskutieren? Kontaktieren Sie gerne: Dr. Carsten Schucht